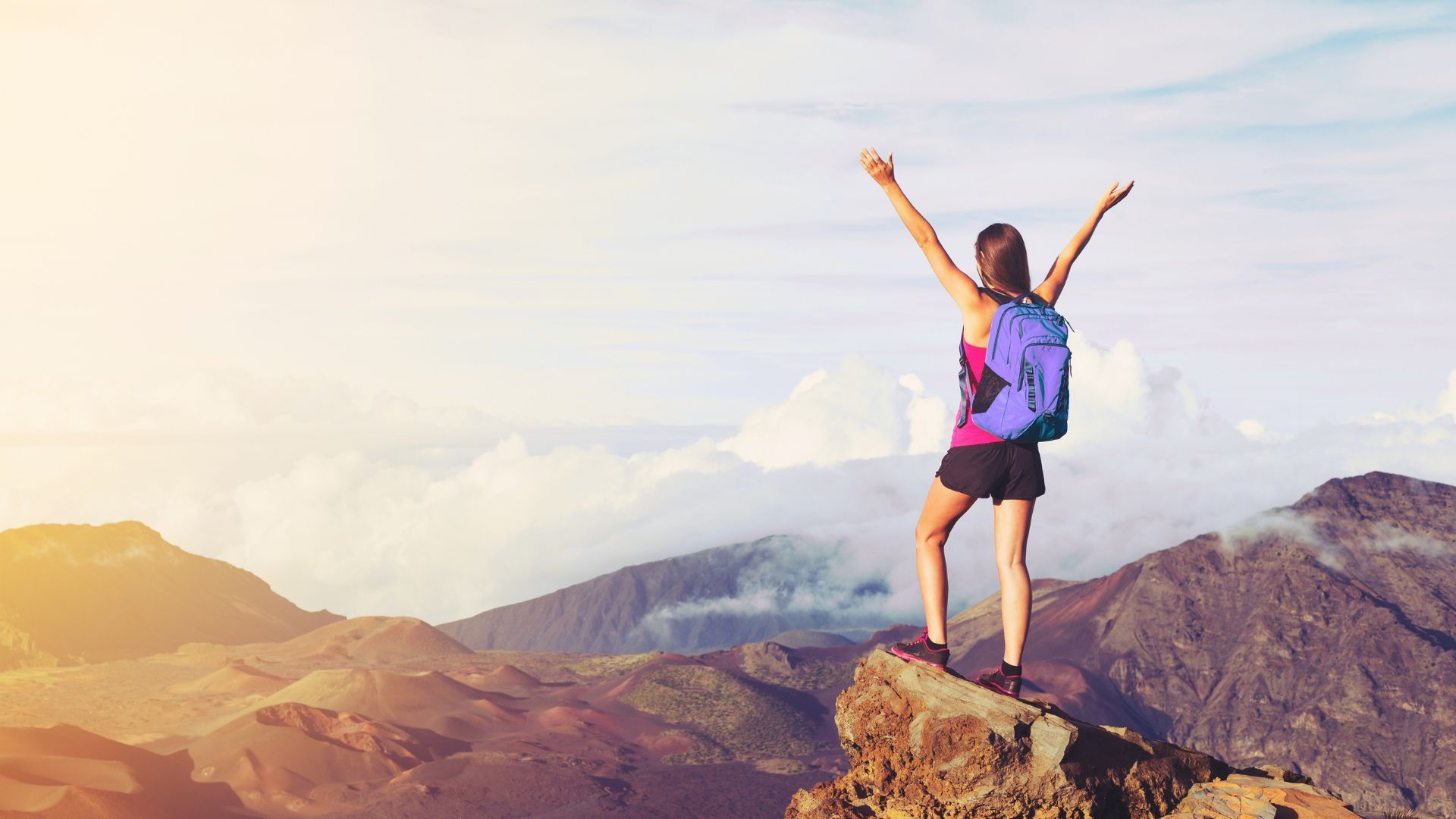Von der inneren Krise zu einem besseren Morgen in ein paar Schritten

Eine Krise ist immer ernst und sollte darum nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Krisen können plötzlich auftreten oder sich über einen längeren Zeitraum anbahnen. Wir fühlen uns dann verletzlich und schutzlos. Es erfordert Mut und Kraft, das zuzugeben, uns aufzuraffen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Anzuerkennen, dass wir uns in einer Krise befinden, ist der erste Schritt heraus aus der Verleugnung, Panik oder Resignation hin zu einer Lösung und einem Weg der Genesung.
Eine Krise, sei sie persönlicher, finanzieller oder sozialer Natur, äußert sich typischerweise durch akuten Stress, das Gefühl von Dringlichkeit oder Zeitlupe, und bedeutet eine erhebliche Störung im normalen Lebensmuster. Die Anzeichen einer Krise können körperlicher, emotionaler und verhaltensbezogener Natur sein – oft all das zusammen. Körperlich können wir Symptome wie Müdigkeit, Schmerzen und Schlaflosigkeit verspüren. Emotional können Gefühle wie Angst, Depression, Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit vorherrschen. Verhaltensmäßig kann man Veränderungen des Appetits, sozialen Rückzug, Gleichgültigkeit oder erhöhten Substanzkonsum feststellen. In einer solchen Situation erfordert es enorme Anstrengungen, unsere Bedürfnisse zu priorisieren und die nächsten Schritte zu definieren.
In einer Krise vergessen wir manchmal unsere Ressourcen. Aber Tatsache ist: Sie sind nicht verloren gegangen! Die Nutzung kognitiver und psychologischer Ressourcen ist unerlässlich, um jeder Krise lösungsorientiert zu begegnen. Zu den kognitiven Ressourcen gehören Problemlösungsfähigkeit, kritisches Denken und Entscheidungsvermögen. Zu den psychologischen Ressourcen zählen wir Umgang mit Emotionen, Belastbarkeit und Bewältigungsstrategien. Das klingt wahrscheinlich sehr theoretisch für etwas, das wir tief und stark in unserem Körper und Geist erleben. Schauen wir es uns also näher und von einem praktischen Standpunkt an:
1. Problemlösungsfähigkeit: In einer Krise – insbesondere einer beruflichen oder finanziellen – kann uns strukturiertes Problemlösen im Team helfen, überwältigende Probleme in überschaubare Teile zu zerlegen. Dabei geht es darum, die anfängliche Ursache der Krise zu identifizieren: Was ist wo und wann schiefgelaufen? Wie können wir potenzielle Lösungen generieren? Wer sollte diese Lösungen bewerten und die beste Option umsetzen? Eine kontinuierliche Überwachung des Ergebnisses stellt sicher, dass bei Bedarf Anpassungen vorgenommen werden können.
2. Kritisches Denken: Dies bedeutet, die Situation unvoreingenommen auf verschiedenen Ebenen zu analysieren, Annahmen in Frage zu stellen und verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen, bevor wir Entscheidungen treffen. Besonders wenn Emotionen im Spiel sind, kann dies eine Herausforderung darstellen, da wir in der Lage sein müssen, die Meinungen anderer zu respektieren und zu akzeptieren. Kritisches Denken hilft, reflexartige Reaktionen zu vermeiden und verhindert, dass wir in ein Vakuum geraten. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Entscheidungen vernünftig und ausgewogen sind.
3. Entscheidungsfähigkeit: Eine vernünftige Entscheidungsfindung erfordert, dass wir die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen so objektiv wie möglich abwägen, potenzielle Ergebnisse vorhersehen und die Vorgehensweise wählen, die am besten mit unseren Zielen und Werten übereinstimmt. In einer persönlichen oder sozialen Krise fühlen wir uns jedoch vielleicht aus der Bahn geworfen, gelähmt, wie in der Zeit eingefroren. Bevor wir dann über Ziele, Werte und Entscheidungen nachdenken können, müssen wir zunächst den Wunsch haben, "aufzutauen" und aus diesem negativen Geisteszustand herauszukommen. Ein guter Anfang ist, jeden Tag kleine Entscheidungen zu treffen, ohne sich Druck oder Fristen aufzuerlegen. Nach einer Weile wird es uns natürlich vorkommen, jede Woche etwas im Voraus zu planen und so unserem Leben Struktur zu verleihen.
4. Emotionale Regulierung: Der Umgang mit unseren Emotionen ist in jeder Krise entscheidend. Leichter gesagt als getan, wenn alles in uns in Alarmbereitschaft ist! Um das tun zu können, müssen wir unsere Emotionen anerkennen und akzeptieren, ohne sie zu werten. Wenn wir vermeiden, uns mit ihnen auseinanderzusetzen, führt das zu keinem gesunden Ergebnis. Um sie produktiv nutzen zu können, ist jedoch etwas Übung und Regelmäßigkeit im Umgang mit ihnen erforderlich. Auch hier können wir mit kleinen und einfachen Schritten beginnen: Erinnern wir uns daran, was uns vor der Krise Freude oder Trost gebracht hat – vielleicht ein Hobby, ein Mentoring-Auftrag oder eine gemeinnützige Arbeit. Oder nehmen wir uns einmal am Tag Zeit, um positive Gedanken und aktive Dankbarkeit zuzulassen. Es gibt auch in der Gegenwart immer etwas Positives und etwas, wofür man dankbar sein kann. Das Erlernen von Techniken wie Achtsamkeit, Meditation und Atemübungen kann uns dabei helfen, das emotionale Gleichgewicht wiederzuerlangen und aufrechtzuerhalten. Im Coaching erkundet man oft die andere Seite der als negativ empfundenen Emotionen, indem man sie "umdreht" und als Quellen positiver Energie lernt zu nutzen. Das regelmäßige Praktizieren von Achtsamkeits- und Stressabbautechniken baut in uns ein Reservoir an emotionaler Belastbarkeit auf. So stellen wir sicher, dass wir im Falle einer Krise besser gerüstet sind, um das, was getan werden muss, zu bewältigen und mit unseren emotionalen Reaktionen in Einklang zu bringen.
5. Resilienz: Resilienz ist, wie wir wissen, die Fähigkeit, sich von widrigen Umständen zu erholen. All unsere vergangenen Erfahrungen – Krisen und Misserfolge gleichermaßen – tragen zu unserer Fähigkeit bei, gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Um Resilienz aufzubauen, müssen wir eine Wachstumsmentalität entwickeln, realistische Ziele setzen und Hoffnung und Optimismus bewahren. Aber wie können wir Raum schaffen für Hoffnung und Optimismus, wenn wir gerade am Tiefpunkt angelangt sind und das Gefühl haben, unser Leben sei zum Stillstand gekommen? Eine Möglichkeit könnte sein, unseren Fokus vom Statischen auf die Bewegung zu verlagern: Wenn wir uns die wohltuende Wirkung der Bewegung gönnen (Laufen, Dehnen, Klettern, Tanzen, Schwimmen, Yoga usw.), können sich unser Körper und Geist entspannen, neue Kraft tanken und wiederentdecken, dass es immer einen nächsten Schritt, eine nächste Bewegung, eine nächste Erfahrung gibt.
6. Bewältigungsstrategien: Effektive Bewältigungsstrategien in jeder Krise bedeuten, dass wir Unterstützung in unserem sozialen Netzwerk suchen, uns körperlich betätigen und wichtige Routinen aufrechterhalten. Die soziale Unterstützung durch Familie, Freunde, ein Team oder eine Selbsthilfegruppe kann uns emotionalen Trost und praktische Hilfe bieten. Die körperliche Betätigung hilft, Stresshormone abzubauen und die Stimmung zu verbessern. Jede Routine verleiht dem Leben Struktur und ein Gefühl der Normalität, was in chaotischen Zeiten stabilisierend wirken kann. Aber wir sollten die Wichtigkeit unseres Wertesystems, das jede Bewältigungsstrategie ergänzt und bereichert, nicht ausser Acht lassen. Werte sind die Grundüberzeugungen, die unsere Handlungen und Entscheidungen leiten. In einer Krise kann das Festhalten an unserem Wertesystem Klarheit, einen moralischen Kompass, eine wertvolle Leitlinie oder ein Gefühl von Sinnhaftigkeit schaffen. Aber wie können unsere Werte uns dabei helfen, eine Krise zu überwinden?
Zu wissen, was am wichtigsten ist, hilft dabei, Maßnahmen zu priorisieren und Ressourcen zweckmässig zu verteilen. Wenn beispielsweise das Wohlergehen der Familie ein zentraler Wert ist, werden unsere Entscheidungen davon geprägt, was die Familienmitglieder am besten unterstützt. Der Aufbau und die Pflege starker Beziehungen schaffen ein Netzwerk, auf das wir uns in Krisenzeiten verlassen können. Dadurch, dass wir uns in Zeiten hoher Belastung anderen mitteilen und von ihnen Unterstützung annehmen, verringert sich das Gefühl von Isolation und erhöht sich unsere Widerstandskraft.
Wertekonformes Handeln sorgt für Beständigkeit und Integrität, auch unter Druck. Diese Beständigkeit schafft Vertrauen zu uns selbst und anderen, was entscheidend ist, um Beziehungen aufrechtzuerhalten und in schwierigen Zeiten auf Unterstützung zählen zu können. Das kontinuierliche Reflektieren und Bekräftigen unserer Werte stellen sicher, dass unsere Handlungen auf das ausgerichtet bleiben, was wirklich wichtig ist. Diese Ausrichtung bietet eine stabile und sinnvolle Grundlage, selbst wenn die äußeren Umstände instabil sind.
Werte motivieren uns, in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Beispielsweise kann uns der Wert des persönlichen Wachstums sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext dazu ermutigen, Krisen als Entwicklungsmöglichkeiten und nicht als unüberwindbare Hindernisse zu betrachten. Wenn wir Krisen als Gelegenheiten zum Lernen und Wachsen sehen, fördert das in uns die Fähigkeit, uns anzupassen. Veränderungen anzunehmen und bereit zu sein, Strategien und Ziele anzupassen, ist massgeblich, wenn es darum geht, Krisen zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen. Werte helfen uns auch dabei, ethische Entscheidungen zu treffen, an denen wir festhalten können, selbst wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen. Dies reduziert im Nachhinein innere Konflikte und Schuldgefühle und ermöglicht uns einen klareren Weg nach vorne.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Erkennen einer Krise bedeutet, dass wir auf körperliche, emotionale und verhaltensbezogene Anzeichen achten, die eine Notsituation signalisieren. Die Nutzung unserer kognitiven und psychologischen Ressourcen sowie das Festhalten an unserem Wertesystem ermöglichen es uns, Krisen besser zu überwinden. Der Aufbau von Resilienz durch solche Strategien hilft uns nicht nur dabei, aktuelle Herausforderungen zu bewältigen, sondern bereitet uns auch darauf vor, dass wir zukünftigen Widrigkeiten mit mehr Kraft und Selbstvertrauen begegnen.